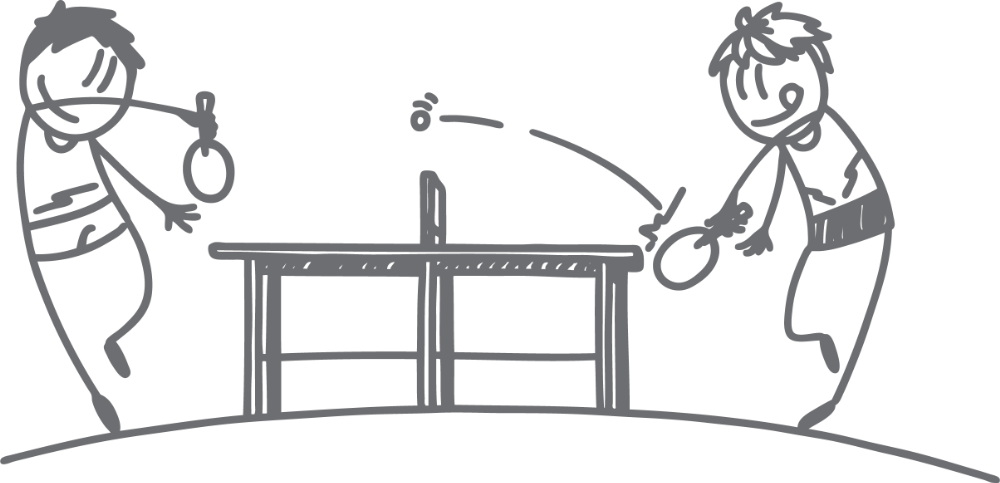Wenn sich die Dämmerung über den Park der Villa Falkenhorst legt und unzählige Lichter die alten Bäume zum Glühen bringen, dann ist sie wieder da – die ganz besondere Stimmung der „Weihnacht auf Falkenhorst“.
Die Bürgermeister der Region und der Verein Villa Falkenhorst laden herzlich ein, gemeinsam in diese zauberhafte Atmosphäre einzutauchen und den Beginn der Feiertage mit allen Sinnen zu genießen: Zwischen duftendem Glühmost, frisch gebackenen Küachle und herzhaftem Raclette finden sich Nachbarn, Familien und Freundeskreise zusammen, um das Jahr bei Lichterglanz und Musik ausklingen zu lassen. Das historische Anwesen und der weitläufige Park bieten dafür die wohl schönste Kulisse – festlich geschmückt, warm beleuchtet und von einer ganz eigenen Magie erfüllt.
Musikalisch begleitet wird der Nachmittag traditionell von den Musikerinnen und Musikern der Militärmusik Vorarlberg, die mit weihnachtlichen Klängen festliche Stimmung verbreiten. Der Falkenhorst-Chor fügt dem Abend eine weitere, vertraute, herzliche Note hinzu – ein gemeinsamer Klang, der weit über den Park hinaus trägt.
Auch die kleinen Besucherinnen und Besucher kommen voll auf ihre Kosten: Im Salon öffnet die Werkelstube von Sabine Burtscher ihre Türen und lädt zum fröhlichen Basteln ein – ein Ort, an dem kleine Hände große Kunstwerke entstehen lassen. Draußen funkelt das Steinlabyrinth im Lichterglanz und verwandelt den Park in ein leuchtendes Wintermärchen.
Doch die Weihnacht auf Falkenhorst steht nicht nur für Gemeinschaft und Genuss, sondern auch für Solidarität: Der Reinerlös des Abends kommt dem Verein Netz für Kinder zugute und unterstützt damit Familien und Kinder in schwierigen Lebenslagen – ein schöner Gedanke, der den Geist der Weihnacht auf besondere Weise lebendig macht.
So wird die Weihnacht auf Falkenhorst auch in diesem Jahr wieder zu einem Ort der Begegnung und des Miteinanders – ein Nachmittag, an dem man das Wesentliche spürt: Wärme, Musik, Lachen und das Gefühl, gemeinsam etwas Gutes zu tun.
Wir freuen uns auf viele Besucherinnen und Besucher, die diesen besonderen Abend mit uns teilen und die Magie des Advents auf Falkenhorst erleben möchten.